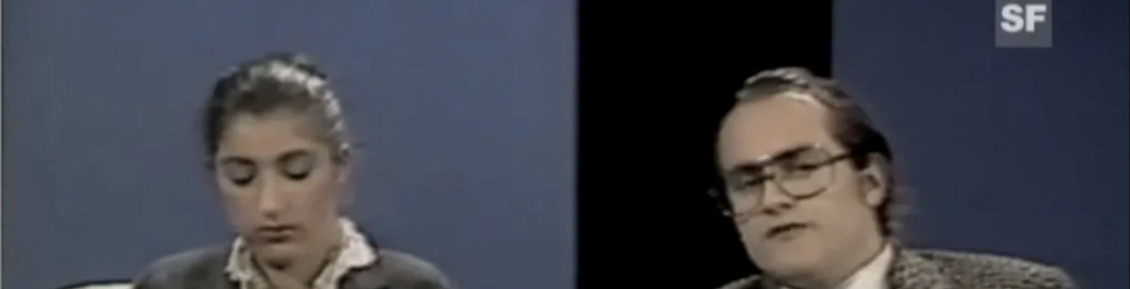Die Lehrperson betritt das Schulzimmer einige Minuten, bevor der Unterricht beginnt. Die Schüler:innen sitzen an ihren Plätzen und sind in die Unterlagen der letzten Lektion vertieft. Damit sie wissen, wo es weitergeht, wenn die Lehrperson gleich mit dem Unterricht beginnen wird. Alle folgen konzentriert dem Geschehen. Sie stellen Fragen, machen bei der Diskussion lebhaft mit. In der Gruppenarbeitsphase dasselbe: Alle tragen zum Gelingen bei. Das Beste kommt am Ende: Es wird applaudiert. Nur dass sich die Klasse heute nicht zur Standing Ovation erhebt, ist anders als sonst. Aber auch heute tritt ein Schüler noch ans Pult der Lehrperson und bedankt sich für die wertvollen Einsichten. Und eine Schülerin begleitet die Lehrperson noch auf den Flur, um einen Aspekt der Lektion zu vertiefen.
Die Schilderung hat etwas Unheimliches. Wer als Lehrperson mit Jugendlichen zu tun hat, hat schon in den ersten Sätzen gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Ganz zu schweigen vom Ende, wo die Übertreibung offenkundig wird. Würde es sich um eine Kunstperformance handeln, könnte man mit der Zürcher Slawistikprofessorin Sylvia Sasse von «subversiver Affirmation» sprechen. In ihrem letztes Jahr erschienenen Buch beschreibt sie an konkreten Beispielen, wie die übertreibende Nachahmung zu einem kritischen Kommentar werden kann. Das in der Schweiz bekannteste Beispiel ist das «Müllern»: In den 1980er-Jahren der sog. Zürcher Jugendunruhen brachten zwei Mitglieder aus der «Bewegung» eine Fernsehsendung durcheinander. Entgegen der Erwartungen präsentierten sie sich nicht als «Chaoten». Bieder gekleidet, forderten sie als «Herr und Frau Müller» eine härtere Hand von den Einsatzkräften der Polizei. Sie unterliefen dadurch das Setting der Diskussionsrunde.
Die Anfangsszene, so betrachtet, legt auch etwas offen, nämlich einen möglichen Erwartungshorizont von uns Lehrpersonen. In Gesprächen über Klassen wird immer wieder deutlich: Ärger und Frust von Lehrpersonen rühren auch daher, dass die Realität eben anders ist als in der beschriebenen Klasse. Die Schüler:innen sind nicht so überpünktlich und hypermotiviert. Die allerwenigsten haben auf nichts anderes als unseren Unterricht gewartet. Ablenkungen aller Art prägen ihren Schulalltag. Dabei hat man sich Mühe gegeben und bis spät in den Abend hinein an der Lektion gefeilt. Als Lehrperson würde man das wohl nie so formulieren, aber es wäre doch schön, wenn die Realität etwas mehr von dieser Anfangsschilderung hätte. Wenn es etwas mehr Würdigung und Anerkennung von den Jugendlichen gäbe. Es muss ja nicht gleich Applaus sein.
In meiner Erfahrung beschäftigt man sich als Lehrperson mit Gewinn mit dieser Thematik. Es gehört zu unserem Beruf, dass wir von den stillen Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit zehren müssen. Dass Standing Ovations eher selten sind. Wer das Verhalten der Jugendlichen einzuordnen vermag, wer Absorbiertheit, Entmutigung und Desinteresse nicht auf sich und seinen Unterricht bezieht, hat einen unverstellteren Blick auf die Situation im Klassenzimmer. Ein solcher ist, so meine Überzeugung, Voraussetzung für pädagogisch adäquates Handeln – mit einem Blick möglichst frei von Selbstbezogenheiten.
Jürg Berthold
WB_40_2025