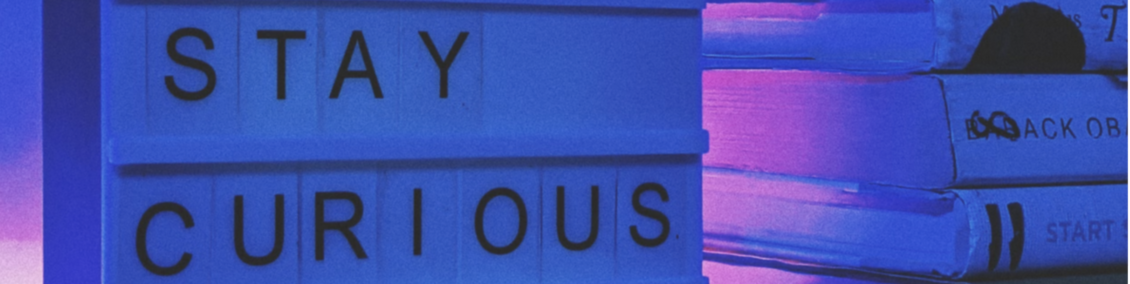«Der KI-Weiterbildungstag war interessant und auch ernüchternd - da kommt ziemlich etwas auf uns zu, respektive ist es ja schon da», schrieb mir eine Lehrerin nach dem Weiterbildungstag der Lehrpersonen der KUE zum Thema «KI in der Bildung».
Ernüchterung kommt auf, wenn man sich mit der Frage befasst, wie man in Zeiten von KI unterrichten sollte. Es begegnen einem die allgemeinen Herausforderungen im Zusammenhang mit KI: die Aufweichung des Schutzes des geistigen Eigentums, die Frage der Kontrolle der KI durch den Menschen, die ökologischen Kosten der Technologie, die Frage des Datenschutzes. Eine Fokussierung auf unser Handeln im Unterricht, auf unseren Kernauftrag, ist daher hilfreich, um sich nicht lähmen zu lassen. Ausgangspunkt für Überlegungen zum Thema können dabei Aussagen von Schüler:innen unterschiedlicher Klassenstufen sein.
«Die Schule könnte den Schülern helfen. Zum Beispiel könnten sie Kurse anbieten oder zeigen, wie man mit KI richtig lernt und damit umgeht.»
Nicht nur von Seiten der Schülerinnen und Schüler, auch von Seiten der Gesellschaft liegen hohe Erwartungen auf den Schulen: Der Umgang mit KI als eine neue Kompetenz muss an der Schule erworben werden. Dazu gehört auch die kritische Reflexion über KI. Insofern ist es keine Option, KI ganz auszuschliessen.
«Manchmal habe ich gar keine Zeit, weil es immer mehr Aufgaben gibt. Mit ChatGPT dauert es nur 30 Sekunden, bis man etwas Gutes hat.»
«Wenn ich mit ChatGPT einen Text schreibe, weiss ich manchmal nicht genau, was drinsteht.»
Die erziehungswissenschaftliche Forschung geht davon aus, dass für die Ausbildung von Kompetenzen wie Kreativität und kritischem Denken, für die Studierfähigkeit und die Gesellschaftsreife bestimmte Grundkompetenzen aufgebaut und verinnerlich werden müssen. Das bedeutet, es muss Räume für das selbstständige Denken und für Erfolgserlebnisse im Unterricht geben, auch damit die Schülerinnen und Schüler das Gefühl der Selbstwirksamkeit erleben. Es liegt in der Verantwortung der Lehrperson, diese Räume zu schaffen. Dafür ist die Kontrolle des Einsatzes der Laptops im Präsenzunterricht unerlässlich.
«Die Lehrerpersonen sollten sich weiterentwickeln, damit sie Aufgaben so stellen können, dass Schülerinnen sie selbstständig lösen und nicht mit Hilfe von KI.»
Die Allgegenwart von KI beeinflusst die didaktische Moderation des Unterrichtsgeschehens. Der Einsatz von KI im Unterricht muss einer gründlichen Prüfung unterliegen. Werden die Funktionen der KI lernförderlich genutzt, sind sie an die Klassenstufe, die Kompetenzen und den Wissenstand angepasst?
«Ich habe das Gefühl, dass man beim Lernen viel mehr mitnimmt, wenn die Lehrpersonen den Prozess Schritt für Schritt sehen können. Dadurch wird weniger KI-Unterstützung notwendig.»
Auf selbstorganisiertes Lernen und Projekte kann mit Blick auf die oben genannten Kompetenzen nicht verzichtet werden. Da gleichzeitig die Möglichkeit besteht, die meisten Arbeits- und Denkvorgänge an die KI auszulagern, kann nicht mehr nur das Produkt eines Projekts im Fokus stehen. Eine Möglichkeit wäre die engmaschige Betreuung des Arbeitsprozesses. Wenn die Lehrperson den Lernprozess eng begleitet, reduziert sich die Möglichkeit, KI zu benutzen. Dieser Anspruch kollidiert aber mit der Realität: Klassengrössen von 28 Schüler:innen verunmöglichen eine individuelle Betreuung.
«Wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann frage ich ChatGPT: Kannst du mir das nochmals einfacher erklären?»
In der Möglichkeit, KI für individuelles Training zu nutzen, liegt grosses Potential. Eine der Vorhersagen im Hinblick auf Veränderungen in der Bildung durch KI lautet, dass es in Zukunft üblich sein wird, Lernprozesse stark zu individualisieren.
Die nächsten Generationen von Schüler:innen brauchen Unterstützung, damit auch sie ihren Reifeprozess vollziehen und bis zur Matura die gymnasialen Bildungsziele erreichen können. Wenn man bedenkt, dass die letzten 15 Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern gelernt haben, mit Google und der überwältigenden Verfügbarkeit von Wissen im Netz umzugehen, darf man darauf vertrauen, dass auch diese Schülerinnen ihren Wissensdurst und ihr Interesse an der Welt nicht verlieren. Wir müssen ihnen jedoch dabei helfen.
Eugenie Bopp
WB_39_25